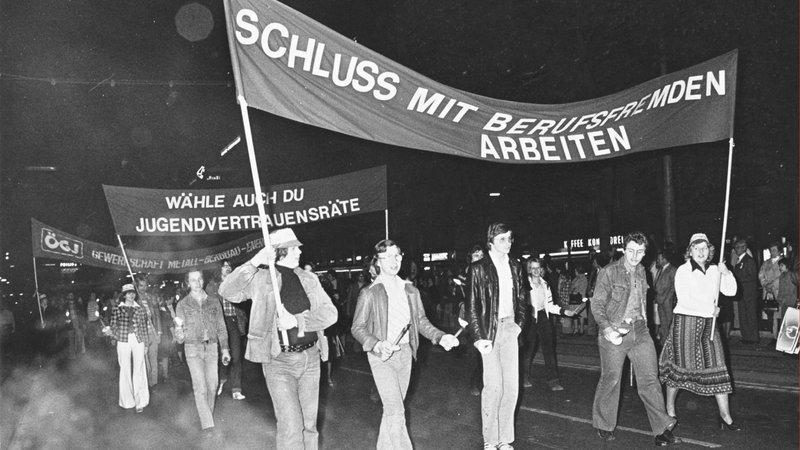Der Schuldenmythos
Yannick Zickler
414 Milliarden Euro! So hoch ist Österreich verschuldet! Jetzt heißt es von der Regierung nur noch: „Sparen, sparen, sparen“; Klima, Kultur, Sport, Arbeitsmarkt, Schulen, Universitäten, Pensionen, Entwicklungshilfe: Überall müsse man den Gürtel enger schnallen.
Als Kind hinterfragte ich all das noch: Wieso sind Schulden denn etwas Schlechtes? Wem schulden wir dieses Geld eigentlich? Können wir nicht einfach Geld drucken, anstatt uns zu verschulden? Bald schon habe ich die typischen Antworten: „Nein das geht nicht“, „Das wäre schlecht für die Wirtschaft“ und „Du verstehst das noch nicht“– akzeptiert und mit dem Fragestellen aufgehört. Im letzten Jahr wurde dann ein „Defizitverfahren“ von der EU gegen Österreich eingeleitet, weil wir nicht genug gespart hatten. Die EU bestimmt nämlich einerseits, dass die gesamten Schulden eines Staats unter 60% seines BIPs sein müssen und andererseits, dass die neuen Schulden von einem Jahr (das Defizit) unter 3% des BIPs sein müssen. So stellte ich mir die kindlichen Fragen wieder. Einige andere Fragen kamen noch dazu: Woher kommen diese Zahlen von 60% und 3%? Mehr und mehr hatte ich also das Gefühl, dass das alles eigentlich gar keinen Sinn macht. Durch Zufall stieß ich dann auf eine Wirtschaftstheorie, die Moderne Geldtheorie (MMT), die mir endlich diese Fragen beantworten konnte. Sie beginnt mit einer sehr schlichten Frage, doch im Zuge der Beantwortung dieser eröffnet diese einen ganz neuen Blick auf das Wesen von Geld.
Wie entsteht eigentlich Geld?
In den allermeisten Transaktionen wechselt Geld einfach Hände: Wenn ich mir z.B. beim McDonald’s ein Kanzlermenü für 9€ kaufe, gebe ich 9€ aus und McDonald’s nimmt 9€ ein. Dieses Geld musste ich davor schon gehabt haben. Aber irgendwoher muss das Geld ursprünglich gekommen sein. Irgendwann muss also Geld ausgegeben worden sein, ohne dass es zuvor jemand besessen hatte, sonst gäbe es ja gar kein Geld! Diese sogenannte „Geldschöpfung“ kann nur auf zwei Arten passieren:
Durch private Schulden
Kann ich mir das Kanzlermenü nicht leisten, muss ich zur Bank (oder auf Klarna), um mir Geld auszuborgen. Die Bank hat selbst ein Konto, bei der „Bank der Banken“, der Zentralbank. Eine europäische Bank muss auf diesem ihrem Konto aber nur 1% von dem Geld haben, welches sie in Form von Schulden hergibt. Alles andere wurde von der Bank durch den Kredit „per Knopfdruck“ neu geschaffen.
Durch öffentliche „Schulden“
Der Staat gibt selbst für verschiedenste Dinge Geld aus. Er hat dafür genauso ein Konto bei der Zentralbank, von dem er Geld für öffentliche Ausgaben abzieht und Steuerzahlungen und andere Abgaben einzahlt. Daher sprechen Politiker*innen immer vom Geld „des Steuerzahlers“, welches für die Spitäler, Straßen und Kindergärten verwendet wird. Doch woher haben Steuerzahler*innen das Geld, um ihre Steuern zu bezahlen? Ist die Person nicht gerade verschuldet und hat das Geld nicht von einer Person oder einem Unternehmen, welches verschuldet ist, muss sie es (über Umwege) aus öffentlichen Ausgaben bezogen haben. Der Staat muss also – will er Privatverschuldung vermeiden – zuerst Geld ausgeben, und kann dieses erst danach in Form von Steuern zurückbekommen, anders geht es sich gar nicht aus! So entsteht unser Privatvermögen überhaupt erst Euro für Euro aus den Ausgaben des Staates. Und genauso kann der Staat gar nicht „sparen“, er müsste mehr einnehmen, als er ausgibt und seine Schulden damit Euro für Euro aus unseren Privatvermögen tilgen.
Doch was passiert, wenn der Staat einfach mehr ausgibt, als er einnimmt? Kann ihm das Geld ausgehen?
Der MMT nach: nein! Die Ökonomin Stephanie Kelton beschreibt das anhand eines Bibers und seines Damms. Wir könnten uns die Frage stellen, woher der Biber das Geld hätte, um den Damm zu bauen. Dieser hätte sich wahrscheinlich einfach gedacht: „Da drüben gibt es Äste und Stöcke, die hole ich mir jetzt und baue meinen Damm“ Und wir Menschen, die Krone der Schöpfung, hätten Beton und Arbeitskräfte, würden aber herumsitzen und uns fragen, woher wir das Geld bekommen. „Wer ist hier verrückt?“, fragt sie abschließend.
Und würden übermäßige Ausgaben nicht zu Inflation führen?
Der MMT nach: unter Umständen! So gäbe es ein Problem für den Biber dann – um im Beispiel zu bleiben –, wenn er keine Äste und Stöcke findet. Dann könnte man ihn fragen: „Wieso schaffst du nicht einfach mehr Geld, um einen Damm zu bauen?“ und er müsste sich wieder denken: „Wer ist hier verrückt?“ Der Staat ist also nicht in seinem Geld, aber durchaus in seinen Ressourcen und seiner Arbeitskraft begrenzt. Schöpft er über diese Grenzen hinaus Geld, dann würde das nur Preise und Löhne erhöhen und damit zur befürchteten Inflation führen. Diese Grenze liegt aber offensichtlich nicht bei exakt 60% des BIPs, sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, auch z.B. wofür Geld ausgegeben wird. Vielleicht gibt es im Beispiel ja keine Äste und Stöcke mehr, aber dafür Steine und Büsche, die der Staat mit neu geschaffenem Geld kaufen könnte, um seinen Damm zu bauen.
Aber wenn Staaten nicht pleitegehen können – wie konnte Griechenland 2010 dann das Geld ausgehen?
Die Eurokrise
Innerhalb der Europäischen Union kann Geld rechtlich nicht einfach so geschöpft werden, wie das bei den Bibern aus dem Beispiel der Fall ist. Die Staaten müssen sich das Geld tatsächlich vorher vom Finanzmarkt ausborgen. Sie verkaufen Staatsanleihen, also das Versprechen, dem jeweiligen Käufer innerhalb einer gewissen Zeitdauer den Preis der Anleihe mit Zinsen zurückzuzahlen. 2010, kurz nach der Einführung des Euros, hat es Griechenland nicht mehr geschafft, diese Staatsanleihen fristgerecht auszubezahlen. Die Finanzmärkte sind nervös geworden. Für das erhöhte Risiko haben sie höhere Zinsen verlangt, womit die Verschuldung noch weiter gestiegen ist. Den Banken, die sich auf die Anleihen verlassen haben, ist eine Einkommensquelle abhandengekommen; sie sind vor der Zahlungsunfähigkeit gestanden. Während die EU und der IWF diese mit Krediten gerettet haben, hat die eigene Bevölkerung „den Gürtel enger schnallen“ müssen; Steuererhöhungen, Kürzungen im Pensions-, Gesundheits- und Sozialsystem, Senkung der Löhne und Entlassung von Beamten sowie Privatisierungen waren die Folge. Dadurch ist bis 2013 die Arbeitslosigkeit auf ein Rekordhoch von über 27% gestiegen! Die Leute hatten weniger Geld, konnten sich darum weniger kaufen, weswegen die Wirtschaftsleistung gesunken und die Schuldenquote, die immer im umgekehrten Verhältnis zur Wirtschaftsleistung berechnet wird, weiter gestiegen ist. Diese Quote ist nun höher, als noch vor Einführung der Sparmaßnahmen.
Dass sich eine Regierung über den Finanzmarkt finanzieren muss, dass also der öffentliche Staat abhängig von den privaten Banken ist, und nicht umgekehrt, war aber nicht immer so und ist auch nicht überall so. Somit ist es ein Entschluss, den die EU getroffen hat und keine Notwendigkeit. Sie will das tun um die Zentralbanken Europas weiterhin frei von „politischen Einflüssen“ leiten zu können. Befreit man sie aber von den „politischen“, also den demokratisch-legitimierten Einflüssen – welche bleiben dann noch über?
Die Grenzen der Theorie
Die MMT beschreibt, wie Geld geschöpft wird. Sie kritisiert richtigerweise, dass Institutionen wie die EU eine Geldknappheit beschwören, versteht aber nicht, wieso dieser Mythos entstanden ist. Denn sogar die EU will neuerdings 800 Milliarden Euro für die Wiederaufrüstung Europas schöpfen, während unsere Regierung bei Öffi-Tickets und der Mindestsicherung sparen muss. Geldknappheit für den Sozialstaat, aber Geld im Überfluss für die Waffenindustrie: Das ist kein bloßer Irrtum, das ist Klassenkampf von oben! Ähnlich wirken dann die Forderungen selbst linker MMT-Ökonomen. Basieren diese nur auf einem neuen Verständnis von Geld, können sie auch nur einen anderen Umgang mit diesem fordern, dass etwa mehr investiert oder Reichtum stärker besteuert werden sollte. Doch will man den Kapitalismus nicht nur regulieren, sondern auch überwinden, kann eine reine Analyse seines Geldes niemals ausreichen, sie darf höchstens ein Teil einer Kritik des Kapitalismus als Ganzes sein.